Die Idee der Einheit der Welt als Grundlage einer ökologischen Weltanschauung. Modernisierung im Laufe der Geschichte mythologischer und religiöser Ansichten über die Existenz Die Idee der Einheit des russischen Landes im Kampf gegen das fremde Joch wurde zu einer der führenden in der Kultur und zieht sich wie ein roter Faden durch
Die erste philosophische Schule entstand in der Stadt Milet – einer Küstenstadt in Griechenland, einem der Handelszentren (7.–6. Jahrhundert v. Chr.). Vertreter: Thales, Anaximander, Anaximenes. Der Grundgedanke der Milesischen Schule ist die Einheit allen Seins. Diese Idee erschien in Form einer einzigen materiellen Basis, die mit allen Dingen identisch ist – der Grundursache „arche“.
Thales betrachtete Wasser als das Grundprinzip: „Alles kommt aus Wasser und alles kehrt zu ihm zurück.“ Wasser ist im Verständnis von Thales „Physis“ (flüssiger Aggregatzustand). Thales ist nicht nur als Philosoph, sondern auch als Wissenschaftler bekannt – er erklärte die Ursache einer Sonnenfinsternis, teilte ein Jahr in 365 Tage ein und maß die Höhe der Cheops-Pyramiden. Die berühmteste These von Thales lautet: „Erkenne dich selbst.“
Anaximander – Schüler von Thales. Schrieb eine Abhandlung „Über die Natur“. Als „Arche“ betrachtete Anaximander das „Operon“ – „das, was jenseits der Elemente liegt“, abstrakt, etwas Durchschnittliches, Mittleres, Unendliches. Das Operon enthält Gegensätze – heiß und kalt, trocken und nass usw. Das Vorhandensein von Gegensätzen ermöglicht es ihm, verschiedene Dinge hervorzubringen. Das Operon ist nicht zu sehen. Das Operon ist ewig (hat weder einen zeitlichen Anfang noch ein zeitliches Ende).
Anaximander war der erste, der eine nicht-mythologische Theorie über den Ursprung des Universums und eine primitive Evolutionstheorie über den Ursprung des Lebens aus Wasser vorschlug. Am Anfang von allem stand ein unendlicher Anfang, der alle Elemente in gemischter Form umfasste. Dann wurden vom unendlichen Anfang an die primären Elemente gebildet – Feuer, Wasser, Erde, Luft.
Anaximenes – Schüler von Anaximander. Er glaubte, dass alle Dinge aus der Luft entstanden seien und deren Veränderungen durch Kondensation und Verdünnung darstellten. Luft ist eine Substanz mit gegensätzlichen Eigenschaften. Es hängt mit der menschlichen Seele zusammen. „Die Seele bewegt den menschlichen Körper und die Luft bewegt das Universum.“
Die Denker der Milesischen Schule betrachteten die Natur als das erste Prinzip und waren Monisten (sie glaubten, dass alles aus einem Anfang entstand).
Thales als Philosoph. Aristoteles war der erste, der über Thales als Philosophen schrieb. In der „Metaphysik“ heißt es: „Von denen, die sich als Erste mit der Philosophie beschäftigten, hielten die meisten den Anfang aller Dinge nur für die Anfänge der Form der Materie: das, aus dem alle Dinge bestehen, aus dem zuerst.“ sie entstehen und in die sie letztlich hineingehen, und das Grundlegende bleibt, verändert sich aber in seinen Eigenschaften, das ist es, was sie als das Element und den Anfang der Dinge betrachten, und deshalb glauben sie, dass nichts entsteht oder vergeht, da eine solche grundlegende Natur immer erhalten bleibt ... Nicht jeder gibt die Menge und Form eines solchen Anfangs auf die gleiche Weise an, aber Thales – der Begründer dieser Art von Philosophie – hält ihn für Wasser“ 1 / Aristoteles. Metaphysik, Buch. Ich, Kap. 3./. So verstand Aristoteles das Wesentliche der Lehren der ersten Philosophen, die wir spontane Materialisten nennen.
Wasser ist eine philosophische Neuinterpretation des Ozeans, Nun, Abzu (Apsu). Der Titel seines Werkes „Über Prinzipien“ gibt zwar zu, dass Thales zum Konzept des ersten Prinzips gelangt ist, sonst wäre er kein Philosoph geworden. Thales, der das Wasser als einen Anfang versteht, lässt naiverweise die Erde darauf schweben – in dieser Form stellt er auch die Substantialität des Wassers dar, es wohnt unter allem, alles schwimmt darauf.
Andererseits handelt es sich hierbei nicht nur um Wasser, sondern um „intelligentes“, göttliches Wasser. Die Welt ist voller Götter (Polytheismus). Allerdings sind diese Götter in der Welt wirkende Kräfte; sie sind auch Seelen als Quellen des Selbstantriebs der Körper. So hat beispielsweise ein Magnet eine Seele, weil er Eisen anzieht. Die Sonne und andere Himmelskörper werden durch Wasserdampf angetrieben. Das Gesagte lässt sich mit den Worten von Diogenes Laertius über Thales zusammenfassen: „Er betrachtete das Wasser als den Anfang von allem und hielt die Welt für belebt und voller Gottheiten“ 2 / Diogenes Laertius. Über das Leben, die Lehren und Sprüche berühmter Philosophen. M., 1979, p. 71./.
F. Engels betont, dass der spontane Materialismus von Thales „den Kern einer späteren Spaltung“ enthielt 3 / K. Marx, F. Engels Soch, 2. Aufl., Bd. 20, S. 504./. Die Gottheit des Kosmos ist die Vernunft. Was wir hier haben, ist nicht nur die antimythologische Natur von Thales, der an die Stelle von Zeus die Vernunft setzte, Logos, den Sohn des Zeus, der seinen Vater verleugnete, sondern auch die Möglichkeit des Idealismus, der der protophilosophischen Lehre innewohnt.
Der ontologische Monismus von Thales ist mit seinem erkenntnistheoretischen Monismus verbunden: Alles Wissen muss auf eine einzige Basis reduziert werden. Thales sagte: „Vielfalt ist überhaupt kein Indikator für eine vernünftige Meinung.“ Hier sprach sich Thales gegen mythologische und epische Ausführlichkeit aus. „Suchen Sie nach einer klugen Sache, wählen Sie eine gute Sache, damit Sie dem müßigen Gerede gesprächiger Menschen ein Ende setzen.“
2. Das Problem der Bewegung und universellen Variabilität in der Philosophie des Heraklit.
Heraklit (ca. 530–470 v. Chr.) war ein großer Dialektiker. Er versuchte, das Wesen der Welt und ihre Einheit zu verstehen, und zwar nicht auf der Grundlage dessen, woraus sie besteht, sondern darauf, wie sich diese Einheit manifestiert. Als Hauptmerkmal hob er die Eigenschaft der Variabilität hervor (sein Satz: „Man kann nicht zweimal in denselben Fluss steigen“). Es entstand ein erkenntnistheoretisches Problem des Wissens: Wenn die Welt veränderlich ist, wie kann man sie dann erkennen? (Die Grundlage von allem ist Feuer, dies ist auch das Bild des Perpetuum Mobile).
Es stellt sich heraus, dass es nichts gibt, alles wird einfach. Es ist unmöglich, sich überhaupt vorzustellen, dass etwas Existierendes, das plötzlich taub wird, völlig in völliger Stille erstarren würde. In der Empfindung gibt es nur noch eine fließende Welle, die mit den Tentakeln des Geistes nur schwer zu erfassen ist: Sie entgleitet ständig. Dies führt zum extremen Skeptizismus von Kratylos: Über nichts kann man etwas behaupten, denn alles fließt; Sie sagen etwas Gutes über einen Menschen, aber er ist bereits im Schlamm des Bösen verschwunden.
Nach den Ansichten von Heraklit erfolgt der Übergang eines Phänomens von einem Zustand in einen anderen durch den Kampf der Gegensätze, den er den ewigen universellen Logos nannte, d.h. ein einziges Gesetz, das allen Existenzen gemeinsam ist: nicht ich, aber wenn man auf den Logos hört, ist es weise zu erkennen, dass alles eins ist. Laut Heraklit sind Feuer und Logos „äquivalent“: „Feuer ist rational und die Ursache für die Kontrolle über alles“, und er ist der Ansicht, dass „alles durch alles kontrolliert wird“ durch die Vernunft. Heraklit lehrt, dass die Welt, eine von allen, nicht von einem der Götter oder einem der Menschen geschaffen wurde, sondern ein ewig lebendiges Feuer war, ist und sein wird, das sich auf natürliche Weise entzündet und auf natürliche Weise erlischt.
Feuer als Seele des Kosmos setzt Intelligenz und Göttlichkeit voraus. Aber der Geist hat die mächtige Macht, alles zu kontrollieren, was existiert: Er lenkt alles und gibt allem eine Form. Grund, d.h. Der Logos regiert alles durch alles. Darüber hinaus wird der objektive Wert des menschlichen Geistes durch den Grad seiner Angemessenheit gegenüber dem Logos bestimmt, d. h. allgemeine Weltordnung.
Heraklit und das Gesetz des Bewegungswiderspruchs
Das Problem des natürlichen Zusammenhangs aller Phänomene in der Philosophie von Heraklit und Demokrit.
Philosophische Ansichten von Demokrit. Demokrit auf zwei Wissensebenen.
DEMOKRITUS aus Abdera (460 – ca. 370 v. Chr.) – antiker griechischer Philosoph, Enzyklopädist, Schüler von Lev-kipnus. Der Begründer des ersten historischen Typs des philosophischen und wissenschaftlichen Atomismus im Westen. Er reiste nach Ägypten, Babylon, Persien, Arabien, Äthiopien und Indien. 70 Werke von D. sind titelmäßig bekannt („On the Nature of Man“, „Small World Building“, „On Ideas“, „On the Goal“ etc.), davon zahlreiche (ca. 300) Fragmente erhalten geblieben. Der Beitrag von D. zur Entwicklung philosophischer Ideen ist sehr groß, aber der wichtigste ist natürlich seine Lehre von den Atomen. D. führte die Idee der Pluralität und Vielfalt in den traditionellen antiken Ursprungsbegriff ein und erklärte extrem kleine materielle Partikel, die mit Hilfe der Sinne nicht direkt wahrgenommen werden können, zu diesem Ursprung. D. setzt diesem kleinsten Anfangsprinzip eine Art Teilungsgrenze, die ab einem bestimmten Stadium nicht mehr möglich ist. Daher kommt auch der Name des Teilchens: atomos (griechisch) – unteilbar. Die Idee eines Plural, Vielfachen, Infinitesimalen, das nicht von den Sinnen wahrgenommen wird und eine Grenze für die Teilung des ersten Prinzips hat, ermöglichte es D., eine Reihe von Problemen in der damaligen Wissenschaft und Philosophie zu lösen: insbesondere zu beantworten die Frage nach den Gründen für die Pluralität und Vielfalt der Dinge, die Einheit und Materialität der Welt, die Einheit von Körper und Material sowie die Erklärung des Wesens des Erkenntnisprozesses. Die Abwesenheit von Atomen ist laut D. Leere (Nichtexistenz), unendlicher Raum, dank dem und in dem die chaotische Bewegung der Atome stattfindet. Atome sind unteilbar (aufgrund ihrer Härte), haben keine Eigenschaften, variieren in Größe, Form, Figur und Gewicht, Lage und Reihenfolge (Umriss, Rotation und Kontakt), befinden sich im leeren Raum und sind in ständiger Bewegung. Durch ihre Verbindung und Trennung entstehen und vergehen Welten und Dinge. (Die Kosmogonie von D. ähnelt den Ansichten von Leukipp über kosmische Wirbel, die unzählige Welten entstehen lassen). D.s Zeit hat keinen Anfang. Laut D. geschieht alles nach einer unklaren und unverständlichen Notwendigkeit (Schicksal) und ist für den Menschen eigentlich identisch mit dem Zufall. Das Wissen um die Ursachen von Phänomenen ist der Sinn wahren philosophischen Wissens. Laut D. ist es besser, „eine kausale Erklärung zu finden, als ein persischer König zu werden.“ Die Seele – die Verkörperung des Elements Feuer – besteht aus speziellen winzigen runden und glatten Atomen, die im ganzen Körper verteilt sind. D. verwendete erstmals den Begriff „Mikrokosmos“ und zog eine Analogie zwischen dem Kosmos und der Organisation des menschlichen Körpers. Götter existieren in Form von Verbindungen feuriger Atome und leben länger als Menschen, ohne unsterblich zu sein. Das Denkorgan ist ausschließlich das Gehirn. Empfindungen entstehen durch das Eindringen von „Bildern“ („Idolen“), die von Dingen ausgehen, in die Seele. Von den Objekten, die Menschen sehen, glaubt D., werden kleine, unsichtbare Partikel abgetrennt und (auf eine bestimmte Weise verbunden) durch die Leere wandern und als Abdruck auf der Netzhaut enden, und dann beginnt die Arbeit des Geistes. Das höchste Gut ist Glückseligkeit, das durch die Eindämmung von Wünschen und Mäßigung im Lebensstil erreicht wird. D. war offenbar der erste, der zwischen angewandter Kunst, die Lernen beinhaltet, und künstlerischer Kreativität, die rational unerklärliche Inspiration erfordert, unterschied. Das Atomkonzept von D. hatte großen Einfluss auf die Geschichte des philosophischen und wissenschaftlichen Denkens und machte das „Atom“ zu einer Art Prinzip zur Erklärung der Existenz, Bewegung, Geburt und des Todes materieller Körper.
Zwei Wissensebenen:
Für Demokrit ist der Mensch nicht nur Seele und Körper, er ist ein ganzer Mikrokosmos. Äußerlich kennen wir einen Menschen, wir müssen jedoch verstehen, was uns an ihm nicht klar ist. Auf der Suche nach einer Antwort auf diese Frage erkannte Demokrit den Sinn des Lebens eines jeden Philosophen. Der Prozess der menschlichen Erkenntnis besteht aus Empfindungen und rationalem Wissen. Das erste, das Sinneswissen, wird von Demokrit als „dunkel“ angesehen, da es durch die Täuschung der Sinne verdeckt wird. Das zweite, rationale Wissen nennt er „Licht“, da es tiefer in das Wesen der Dinge eindringt. Diese beiden Arten der Erkenntnis, durch Empfindungen und Vernunft, erscheinen bei Demokrit als zwei Wissensebenen, die höchste und die niedrigste. Darüber hinaus ergänzen sie sich gegenseitig. Dies deutet darauf hin, dass Demokrit, wenn auch unbewusst, mit dem Konzept der Empfindungsschwelle operierte. Seiner Meinung nach gibt es beispielsweise keinen scharfen Geschmack in der Natur, sondern er entsteht nur in der „Meinung“, wenn die Sinnesorgane von einer Substanz beeinflusst werden, deren Atome scharf und eckig sind. Somit existieren alle Empfindungen (Warm und Kälte, Farbe, Geschmack, Geruch) nur „in der Meinung“, aber „in Wahrheit“ gibt es Atome und Leere. Das ist die Schwierigkeit des Wissens – der Geist kann die Wahrheit nicht ohne Gefühle finden und Gefühlen kann man nicht vertrauen. Die Schwierigkeit der Erkenntnis bestimmt auch die individuellen Gefühle eines Menschen. Demokrit war sich der Komplexität der Beziehung zwischen Subjekt und Objekt bewusst und stellte ein wichtiges Problem, das in der modernen Philosophie als Problem der „primären und sekundären Qualitäten“ bezeichnet wurde. Die primären Eigenschaften sind die Form, Ordnung und Position der Atome. Sie existieren und werden vom Geist erfasst. Sekundäre Qualitäten sind Eigenschaften von Dingen, die sinnlich wahrgenommen werden (Wärme, Kälte, Geruch etc.). Sie existieren „in der Meinung“.
6. Philosophische Ansichten von Pythagoras und seiner Schule. Gesetze der Welt und Mathematik.
Im Gegensatz zu den ionischen Denkern, die einzelne Substanzen – Wasser, Luft, Feuer – als grundlegende Grundlage natürlicher Phänomene betrachteten, betrachtete Pythagoras Zahlen als Grundlage aller Dinge, die seiner Meinung nach die Grundlage für die Ordnung im Universum bilden und Gesellschaft. Daher sollte das Wissen über die Welt darin bestehen, dass die Zahlen diese Welt regieren. Dies war das große Verdienst von Pythagoras, der im Wesentlichen auch die Frage nach der Bedeutung der quantitativen Seite der umgebenden Welt stellte viel in der Entwicklung der Geometrie.
Pythagoras wird die Formulierung des sogenannten Satzes des Pythagoras zugeschrieben (das Quadrat der Hypotenuse ist gleich der Summe der Quadrate der Katheten). Pythagoras teilte alle Zahlen in gerade und ungerade ein. Die Basis aller Zahlen wurde als Einheit erkannt, die als gerade-ungerade Zahl betrachtet wurde. Die Einheit ist eine heilige Monade, die als Ursprung und Basis der umgebenden Welt fungierte. Zahlen fungierten somit als das wahre Wesen aller Dinge. Pythagoras und die Pythagoräer legten den Grundstein für die Zahlentheorie und die Prinzipien der Arithmetik. Gleichzeitig führte die dominierende Bedeutung der Zahl zur Verabsolutierung der Zahl, zur Zahlenmystik. So beschreibt Diogenes Laertius die Ansichten der Pythagoräer: „Der Anfang von allem ist eins, die Einheit als Ursache unterliegt dem unbestimmten Binärsystem als Substanz, aus der Einheit und dem unbestimmten Binärsystem entstehen Zahlen, aus Zahlen – Punkte, aus Punktlinien daraus - flache Figuren, aus flachen - dreidimensionale Figuren, aus denen - sinnlich wahrgenommene Körper, in denen es vier Basen gibt - Wasser und Feuer, Erde und Luft, die sich vollständig bewegen und verwandeln, entstehen ein belebtes, intelligentes, kugelförmiges, in dessen Mitte sich die Erde befindet, und die Erde ist ebenfalls kugelförmig und von allen Seiten bewohnt“ [Diogenes Laertius. Über das Leben... S. 338-339].
Die Pythagoräer studierten auch Musiktheorie, Bildhauerei und Architektur. Sie leisteten einen wesentlichen Beitrag zur Theorie der bildenden Künste in Bezug auf das Problem des „Goldenen Schnitts“ – der richtigen Beziehung zwischen einzelnen Gebäudeteilen und Skulpturengruppen (die „Goldene Schnitt“-Regel: wenn das Segment AC an einem Punkt geteilt wird B, dann sollte das Verhältnis des Segments AB zu BC so sein, wie auch das Verhältnis des gesamten Segments AC zu BC).
Die Zahlentheorie des Pythagoras ist mit seiner Gegensatzlehre verbunden, die darin bestand, dass alle Dinge Gegensätze sind: rechts – links, männlich – weiblich, Ruhe – Bewegung, gerade – schief, hell – dunkel, gut – böse usw. . Von besonderer Bedeutung für Pythagoras war der Gegensatz „Grenze – Unendlich“: Die Grenze ist Feuer und das Unendliche ist Luft. Seiner Meinung nach besteht die Welt aus dem Zusammenspiel von Feuer und Luft (Leere).
Ein besonderer Bereich in den Ansichten des Pythagoras sind seine religiösen, politischen und ethischen Vorstellungen, seine Vorstellungen von Seele und Körper. Er glaubte, dass die menschliche Seele unsterblich ist, dass sie vorübergehend einen sterblichen Körper bewohnt und dass diese Seele nach dem Tod in einen anderen Körper übergeht und wiedergeboren wird (Metempsychose). In diesem Fall wird angenommen, dass sich ein Mensch an alle seine Inkarnationen erinnert, die in der Vergangenheit stattgefunden haben. Pythagoras glaubte, dass das höchste ethische Ziel die Katharsis sei – die Reinigung, die für den Körper durch Vegetarismus und für die Seele durch die Wahrnehmung der harmonischen Struktur des Kosmos, ausgedrückt in den grundlegenden musikalischen Intervallen, erfolgt.
Der Pythagoräismus existierte seit dem 6. Jahrhundert. Chr nach dem Sh Jahrhundert
7. Das Problem des Menschen in der Philosophie des Sokrates. Sokrates über die Bedeutung und verallgemeinerte Konzepte im Wissen über die Welt und die Prinzipien des menschlichen Lebens.
Sokrates ist der grundlegende Feind des Naturstudiums. Er betrachtet die Arbeit des menschlichen Geistes in dieser Richtung als einen gottlosen und fruchtlosen Eingriff in die Arbeit der Götter. Für Sokrates scheint die Welt die Schöpfung einer Gottheit zu sein, „so groß und allmächtig, dass sie alles gleichzeitig sieht, alles hört, überall anwesend ist und für alles sorgt.“ Um die Anweisungen der Götter bezüglich ihres Willens zu erhalten, ist Wahrsagerei und keine wissenschaftliche Forschung erforderlich. Und in dieser Hinsicht unterschied sich Sokrates nicht von jedem unwissenden Bewohner Athens. Er folgte den Anweisungen des Delphischen Orakels und riet seinen Schülern, dasselbe zu tun. Sokrates brachte den Göttern sorgfältig Opfer dar und führte im Allgemeinen alle religiösen Rituale gewissenhaft durch. Sokrates erkannte die Begründung einer religiösen und moralischen Weltanschauung als Hauptaufgabe der Philosophie an, hielt Naturerkenntnis und Naturphilosophie jedoch für eine unnötige und gottlose Angelegenheit. Zweifel („Ich weiß, dass ich nichts weiß“) soll nach der Lehre des Sokrates zur Selbsterkenntnis („Erkenne dich selbst“) führen. Nur auf solch individualistische Weise, so lehrte er, könne man zu einem Verständnis von Gerechtigkeit, Recht, Gesetz, Frömmigkeit, Gut und Böse gelangen. Materialisten, die die Natur studierten, kamen dazu, den göttlichen Geist in der Welt zu leugnen, die Sophisten stellten alle bisherigen Ansichten in Frage und machten sie lächerlich – daher ist es laut Sokrates notwendig, sich der Erkenntnis von sich selbst, dem menschlichen Geist, zuzuwenden und in ihm das zu finden Grundlage von Religion und Moral. So löst Sokrates als Idealist die wichtigste philosophische Frage: Das Wichtigste für ihn ist der Geist, das Bewusstsein, während die Natur etwas Zweitrangiges und sogar Unbedeutendes ist, das der Aufmerksamkeit des Philosophen nicht würdig ist. Der Zweifel diente Sokrates als Voraussetzung für die Hinwendung zu sich selbst, zum subjektiven Geist, für den der weitere Weg zum objektiven Geist – zum göttlichen Geist – führte. Die idealistische Ethik des Sokrates entwickelt sich zur Theologie.
Bei der Entwicklung seiner religiösen und moralischen Lehren berief sich Sokrates im Gegensatz zu Materialisten, die dazu auffordern, „auf die Natur zu hören“, auf eine besondere innere Stimme, die ihn angeblich in den wichtigsten Fragen unterrichtete – den berühmten „Dämon“ des Sokrates. Sokrates widersetzt sich dem Determinismus der antiken griechischen Materialisten und skizziert die Grundlagen einer teleologischen Weltanschauung, und hier ist der Ausgangspunkt für ihn das Subjekt, denn er glaubt, dass alles auf der Welt das Wohl des Menschen zum Ziel hat. Die Teleologie des Sokrates erscheint in einer äußerst primitiven Form. Die Sinnesorgane des Menschen haben nach dieser Lehre die Aufgabe, bestimmte Aufgaben zu erfüllen: Die Augen dienen dem Sehen, die Ohren dem Hören, die Nase dem Riechen usw. Ebenso senden die Götter das Licht, das die Menschen zum Sehen benötigen, die Nacht ist von den Göttern für den Rest der Menschen bestimmt, das Licht des Mondes und der Sterne soll dabei helfen, die Zeit zu bestimmen. Die Götter sorgen dafür, dass die Erde Nahrung für die Menschen produziert, wofür ein entsprechender Zeitplan der Jahreszeiten eingeführt wurde; Darüber hinaus erfolgt die Bewegung der Sonne in einer solchen Entfernung von der Erde, dass der Mensch nicht unter übermäßiger Hitze oder übermäßiger Kälte usw. leidet. Sokrates hat seine philosophische Lehre nicht schriftlich niedergelegt, sondern durch mündliche Gespräche in Form einer einzigartigen, methodisch ausgerichteten Auseinandersetzung verbreitet. Sokrates beschränkte sich nicht nur auf eine führende Rolle innerhalb seines philosophischen und politischen Kreises, sondern wanderte durch Athen und überall hin – auf Plätzen, auf der Straße, an Orten öffentlicher Versammlungen, auf einem ländlichen Rasen oder unter einem Marmorportikus –, mit dem er „Gespräche“ führte Athener und Fremde, die zu Besuch kamen, stellten ihnen philosophische, religiöse und moralische Probleme, führten lange Debatten mit ihnen, versuchten zu zeigen, woraus seiner Meinung nach ein wirklich moralisches Leben bestand, sprachen sich gegen Materialisten und Sophisten aus und betrieben unermüdliche mündliche Propaganda ethischer Idealismus.
Die Entwicklung einer idealistischen Moral bildet den Kern der philosophischen Interessen und Aktivitäten von Sokrates.
Sokrates legte besonderen Wert auf die Kenntnis des Wesens der Tugend. Ein moralischer Mensch muss wissen, was Tugend ist. Moral und Wissen fallen unter diesem Gesichtspunkt zusammen; Um tugendhaft zu sein, ist es notwendig, die Tugend als solche zu kennen, als ein „Allgemeines“, das als Grundlage aller besonderen Tugenden dient. Die Aufgabe, das „Universale“ zu finden, hätte laut Sokrates durch seine besondere philosophische Methode erleichtert werden sollen. Die „sokratische“ Methode, deren Aufgabe es war, die „Wahrheit“ durch Konversation, Argumentation und Polemik zu entdecken, war die Quelle der idealistischen „Dialektik“. „In der Antike verstand man unter Dialektik die Kunst, durch die Aufdeckung von Widersprüchen im Urteil des Gegners zur Wahrheit zu gelangen und diese Widersprüche zu überwinden.“ In der Antike glaubten einige Philosophen, dass dies die Offenbarung von Widersprüchen im Denken und das Aufeinanderprallen gegensätzlicher Meinungen sei
das beste Mittel, die Wahrheit herauszufinden.“
Während Heraklit den Kampf der Gegensätze als treibende Kraft der Naturentwicklung lehrte und sein Augenmerk vor allem auf die objektive Dialektik richtete, hob Sokrates, gestützt auf die eleatische Schule (Zeno) und die Sophisten (Protagoras), erstmals deutlich hervor Frage der subjektiven Dialektik, nach der dialektischen Denkweise. Die Hauptbestandteile der „sokratischen“ Methode: „Ironie“ und „Mäeutik“ – in der Form, „Induktion“ und „Bestimmung“ – im Inhalt. Die „sokratische“ Methode ist in erster Linie eine Methode des konsequenten und systematischen Stellens von Fragen mit dem Ziel, den Gesprächspartner dazu zu bringen, sich selbst zu widersprechen und seine eigene Unwissenheit einzugestehen. Das ist die sokratische „Ironie“. Sokrates stellte sich jedoch nicht nur die „irische“ Offenlegung von Widersprüchen in den Aussagen seines Gesprächspartners zur Aufgabe, sondern auch die Überwindung dieser Widersprüche, um zur „Wahrheit“ zu gelangen. Die Fortsetzung und Ergänzung von „Ironie“ war daher „Mäeutik“ – die „Hebammenkunst“ des Sokrates (eine Anspielung auf den Beruf seiner Mutter). Sokrates wollte damit sagen, dass er seinen Zuhörern dabei half, in ein neues Leben hineingeboren zu werden, in die Erkenntnis des „Allgemeinen“ als Grundlage wahrer Moral.
Die Hauptaufgabe der „sokratischen“ Methode besteht darin, das „Allgemeine“ in der Moral zu finden, eine universelle moralische Grundlage für einzelne, besondere Tugenden zu schaffen. Dieses Problem muss durch eine Art „Induktion“ und „Definition“ gelöst werden. Das Gespräch des Sokrates basiert auf den Tatsachen des Lebens, auf bestimmten Phänomenen. Er vergleicht einzelne ethische Tatsachen, identifiziert daraus Gemeinsamkeiten, analysiert sie, um widersprüchliche Punkte zu entdecken, die ihre Vereinigung verhindern, und reduziert sie schließlich auf der Grundlage der gefundenen wesentlichen Merkmale auf eine höhere Einheit. Auf diese Weise gelangt er zu einem Gesamtkonzept. Beispielsweise eröffnete die Untersuchung einzelner Erscheinungsformen von Gerechtigkeit oder Ungerechtigkeit die Möglichkeit, den Begriff und das Wesen von Gerechtigkeit oder Ungerechtigkeit im Allgemeinen zu definieren. „Induktion“ und „Bestimmung“ in der Dialektik von Sokrates ergänzen einander. Wenn „Induktion“ die Suche nach dem Gemeinsamen bestimmter Tugenden durch deren Analyse und Vergleich ist, dann ist „Bestimmung“ die Festlegung von Gattungen und Arten, ihre Korrelation, „Unterordnung“. So wandte Sokrates beispielsweise in einem Gespräch mit Euthydemus, der sich auf die Regierungstätigkeit vorbereitete und wissen wollte, was Gerechtigkeit und Unrecht sind, seine „dialektische“ Denkweise an. Zuerst schlug Sokrates vor, Fälle von Gerechtigkeit in die Spalte „Delta“ und Fälle von Ungerechtigkeit in die Spalte „Alpha“ einzutragen, dann fragte er Euthydemus, wo er die Lüge eintragen solle. Euthydemus schlug vor, Lügen in die Spalte „Alpha“ (Ungerechtigkeit) einzutragen. Das Gleiche schlug er im Hinblick auf Täuschung, Diebstahl und Entführung von Menschen zum Zweck des Verkaufs in die Sklaverei vor. Als Sokrates fragte, ob einer der oben genannten Punkte in die Spalte „Delta“ (Gerechtigkeit) aufgenommen werden könne, antwortete Euthydemus ebenfalls mit einer entschiedenen Ablehnung. Dann stellte Sokrates Euthydemus eine Frage dieser Art: Ist es fair, die Bewohner einer ungerechten feindlichen Stadt zu versklaven? Euthydemus erkannte eine solche Tat als fair an. Dann stellte Sokrates eine ähnliche Frage bezüglich der Täuschung des Feindes und bezüglich des Diebstahls und Raubes von Gütern von den Bewohnern der feindlichen Stadt. Euthydemus erkannte all diese Handlungen als fair an und wies darauf hin, dass er zunächst dachte, dass die Fragen von Sokrates nur Freunde betrafen. Dann wies Sokrates darauf hin, dass alle ursprünglich als Unrecht eingestuften Handlungen in die Spalte der Gerechtigkeit eingeordnet werden sollten. Euthydemus stimmte dem zu. Dann erklärte Sokrates, dass daher die bisherige „Definition“ falsch sei und dass eine neue „Definition“ vorgeschlagen werden sollte: „Gegenüber Feinden sind solche Handlungen gerecht, aber gegenüber Freunden sind sie ungerecht, und gegenüber.“ Im Gegenteil, man sollte so vorsichtig wie möglich sein.“ Sokrates hörte hier jedoch nicht auf und zeigte, indem er wiederum auf die „Induktion“ zurückgriff, dass diese „Definition“ falsch war und durch eine andere ersetzt werden musste. Um zu diesem Ergebnis zu gelangen, entdeckt Sokrates erneut Widersprüche in der von seinem Gesprächspartner als wahr anerkannten Position, nämlich in der These, dass gegenüber Freunden nur die Wahrheit gesagt werden sollte. Wird der Militärbefehlshaber richtig handeln, fragt Sokrates, wenn er, um die Moral der Armee zu heben, seinen Soldaten vorlügt, dass Verbündete im Anmarsch seien? Euthydemus stimmt zu, dass diese Art der Täuschung von Freunden in die Spalte „Delta“ aufgenommen werden sollte und nicht in die Spalte „Alpha“, wie in der vorherigen „Definition“ vorgeschlagen. Ebenso führt Sokrates die „Induktion“ weiter aus: „Wäre es nicht gerecht, wenn ein Vater seinen kranken Sohn, der keine Medizin nehmen möchte, betrügt und ihn unter dem Deckmantel der Nahrung zur Einnahme dieser Medizin zwingt und damit mit seiner Lüge.“ stellt seinen Sohn wieder gesund her? Euthydemus stimmt zu, dass diese Art der Täuschung als fair anerkannt werden sollte. Dann fragt Sokrates ihn, wie er die Tat dieser Person nennen soll, die, als sie ihren Freund in einem Zustand der Verzweiflung sah und befürchtete, dass er Selbstmord begehen würde, ihm die Waffe stahl oder einfach wegnahm. Auch Euthydemus ist gezwungen, diesen Diebstahl bzw. diesen Raub in die Spalte der Gerechtigkeit einzubeziehen, womit er erneut gegen die bisherigen „Definitionen“ verstößt und zu dem von Sokrates vorgeschlagenen Schluss kommt, dass man auch bei Freunden nicht in allen Fällen ehrlich sein dürfe. Anschließend wendet sich Sokrates der Frage nach dem Unterschied zwischen freiwilligem und unfreiwilligem Handeln zu, setzt seine „Induktion“ fort und gelangt zu einer neuen, noch präziseren „Definition“ von Gerechtigkeit und Ungerechtigkeit. Das Endergebnis ist eine Definition von ungerechten Handlungen als solche, die gegen Freunde mit der Absicht begangen werden, ihnen zu schaden. Wahrheit und Moral sind für Sokrates zusammenfallende Konzepte. „Sokrates machte keinen Unterschied zwischen Weisheit und Moral: Er erkannte einen Menschen sowohl als intelligent als auch als moralisch an, wenn ein Mensch, der versteht, was schön und gut ist, sich in seinem Handeln davon leiten lässt und im Gegenteil weiß, was moralisch hässlich ist.“ , vermeidet es ... Gerechte Handlungen und im Allgemeinen sind alle auf Tugend basierenden Handlungen schön und gut. Daher werden Menschen, die wissen, woraus solche Handlungen bestehen, keine andere Handlung als diese begehen wollen, und Menschen, die es nicht wissen, können sie nicht ausführen und geraten, selbst wenn sie es versuchen, in einen Fehler. So können nur die Weisen schöne und gute Taten vollbringen, die Unweise jedoch nicht, und selbst wenn sie es versuchen, geraten sie in einen Irrtum. Und da gerecht und überhaupt alle schönen und guten Taten auf Tugend beruhen, folgt daraus, dass Gerechtigkeit und jede andere Tugend Weisheit ist.“
Jetzt beginnt die Idee der Einheit des Volkes in Umlauf zu kommen“, sage ich. - Wie unterscheidet es sich Ihrer Meinung nach von der nationalen Idee?
„Auf den ersten Blick handelt es sich hier um eine Variante zum gleichen Thema“, sagt der Verteidiger. - Aber es gibt einen wesentlichen Unterschied. Dabei geht es nicht so sehr um den verbalen Ausdruck, sondern vielmehr darum, woher die Ideen kommen, wer dahinter steckt, was die Ziele ihrer Initiatoren sind. Die nationale Idee kommt aus Kreisen der Bevölkerung, die sich um das Schicksal Russlands sorgen und es retten wollen. Und die Idee der Einheit kommt von... Erinnern Sie sich, wer sie ausgedrückt hat?...
Das ist es. Es kommt von den Behörden, genauer gesagt vom Kreml. Denken Sie an Hitler und Stalin! Hitler: ein Volk, ein Führer. Stalin: moralische und politische Einheit der Völker und aller Bevölkerungsschichten (befreundete Arbeiter- und Bauernklassen und die werktätige Intelligenzschicht). Die Idee der Einheit der Bevölkerung des Landes ist eine natürliche Idee jeder höchsten Macht. In Ausnahmesituationen kommt ihm jedoch eine besondere Bedeutung zu.
Was ernährt sie jetzt?
Eine ganze Reihe von Bedingungen. Es herrscht Chaos im Land. Wir brauchen Ordnung, die nur eine starke Regierung schaffen kann. Die soziale Krise ist beendet. Es ist notwendig, die Ergebnisse zu konsolidieren. Zwingen Sie die Bevölkerung, die neue soziale Schichtung als eine zweifelsfreie Tatsache anzuerkennen. Für das Funktionieren des Währungsmechanismus ist ein stabiles Leben erforderlich. Dies ist für die neuen herrschenden Eigentümerklassen notwendig. Die Opposition mischt sich in die Regierung ein. Vor allem die „Linke“. Vor allem die Kommunisten.
Ja, die Situation im Land ähnelt der Situation, als das Hitlertum an die Macht kam.
Und vergessen Sie nicht, dass das Großkapital hinter Hitlers Rücken stand.
Obwohl die Massen der Bevölkerung Hitler unterstützten.
Massen der sowjetischen Bevölkerung unterstützten den Stalinismus, obwohl die Verhältnisse in der Sowjetunion anders waren als in Deutschland. Jetzt sind die Bedingungen in Russland schwierig. Sogar verwirrende und widersprüchliche. Die am aktiven Leben Russlands beteiligten Kräfte haben es noch nicht verstanden und keine klare Position entwickelt.
Aber ist es das, worum es geht?
Ja. Ich denke, bald wird alles klar sein.
Wie stellen Sie sich das vor?
Ich denke, es wird einen Wendepunkt geben. Die „starke“ Macht des „Kremls“ wird etabliert. Eine Mischung aus Stalinismus und Hitlerismus, aber nicht auf tragische Weise, wie es war, sondern eher als Farce. Nachahmung-Karikatur-Form.
Was ist ihre Rolle?
Endlich ein neues Gesellschaftssystem etablieren. Stellen Sie eine grundlegende öffentliche Ordnung her. Begrenzen Sie die Gesetzlosigkeit in allen Bereichen der Gesellschaft. Bringen Sie die Opposition in den richtigen Rahmen. Treiben Sie die Opposition in den nötigen Rahmen. Erledigt die Kommunisten. Bereitstellung von Bedingungen für das Funktionieren des globalen Währungsmechanismus.
Was passiert, wenn die neue Regierung die Kontrolle über diesen Mechanismus verliert?
Dieser Trend ist nicht ausgeschlossen. Aber man muss realistisch sein. Selbstverständlich erhält er Handlungsfreiheit und Unterstützung hinter den Kulissen. Allerdings innerhalb der aus Sicht westlicher Eigentümer akzeptablen Grenzen. Als Axiom muss Folgendes verstanden werden: Das wichtigste strategische Ziel des Westens gegenüber der Sowjetunion und Russland war und ist die Zerstörung ihrer inneren Einheit, Zerfall, Atomisierung, Lockerung. Mittel hierfür sind die Demokratisierung der Macht, die Privatisierung der Wirtschaft und die Entideologisierung der geistigen Sphäre. Plus - nationale Zwietracht. Zerstückelung des Territoriums. Überlegen Sie, was die Einheit des Landes gewährleistet hat? Das Machtsystem ist der Parteiapparat, das Einparteiensystem der KPdSU. Im mentalen Bereich gibt es ein einziges ideologisches System. Im Wirtschaftssystem gibt es ein einziges Wirtschaftssystem. Alle Teile des Landes waren in allen wesentlichen Aspekten mit dem Ganzen verbunden. Und jetzt? Egal, was die Autoritäten und ideologischen Diener über die Einheit in der Höhe sagen, es wird keine Einheit ohne die innere Anziehung von Teilen zum Ganzen und ohne die innere Durchdringung verschiedener Aspekte der Gesellschaft – Macht, Wirtschaft, Ideologie – geben. Alle Aspekte sind atomisiert, es gibt keine Entsprechung oder Durchdringung zwischen ihnen.
Erster Schritt: Entspannen Sie sich beim Sitzen und machen Sie es Ihrem Körper bequem.
Nächster Schritt: Augen schließen.
Dritter Schritt: Entspannen Sie Ihre Atmung, machen Sie sie so natürlich wie möglich und sagen Sie bei jedem Ausatmen „eins“. Wenn der Atem herauskommt, sagen Sie „eins“.
Atme ein und sag nichts. Bei jedem Ausatmen sagen Sie einfach „eins“ – „eins“ – „eins“. Und sagen Sie das nicht nur, sondern spüren Sie auch, dass die gesamte Existenz eins ist, eine Einheit. Wiederholen Sie es nicht, lassen Sie einfach das Gefühl da sein – und sagen Sie ...
Einheit entsteht nicht aus Überlegungen und Überzeugungen wie: „Wir sind alle eins, und was auf der Erde geschieht, ist Harmonie.“ Jeder, der mit solchen Slogans operiert, hat keine Ahnung...
Eine junge Frau kam zu einem Beratungsgespräch zu mir und begann mir zu erzählen, dass sich ihr Chef, wie sie es ausdrückte, sadistisch verhalte. Es scheint, dass es ihm Spaß macht, die Menschen um ihn herum zu ärgern.
Die Frau gab zu, dass sie ihn zutiefst hasste. Schon seine Art, eine Pfeife anzuzünden, ekelt sie an. Es ist leicht zu verstehen, was der Grund war. Diese Frau konzentrierte ihre ganze Aufmerksamkeit auf die negativen Aspekte seiner Persönlichkeit: seine Stimme, Kleidung und andere Details, einschließlich der Pfeife und ...
Die Lehren einer Reihe alter indischer Traditionen basieren auf dem Verständnis der Freiheit als wichtigstem ontologischen und methodischen Prinzip. Dies gilt insbesondere für die Vedanta-Schule (veda – Wissen und anta – Vollendung), die Teil des Systems der sechs Hauptschulen (shat-darshana) des vedischen Denkens ist (S. 67 – 71).
Gleichzeitig nimmt das Prinzip der Kausalität einen zentralen Platz im metaphysischen System des Vedanta ein. Dies wird in der Bhagavad-gita (Text 13.5) erwähnt: „Wissen über das Tätigkeitsfeld und das Wissensfeld...“
Der Kaschmir-Shaivismus wird üblicherweise als ein Komplex zahlreicher mystisch-religiöser, ritueller, metaphysischer Theorien und Praktiken verstanden, die sich im 8.-12. Jahrhundert entwickelten. auf dem Gebiet, das heute vom indischen Bundesstaat Kaschmir besetzt ist. Der Eigenname seines Tricks.
Das heißt „Triade“, was entweder die drei Aspekte von Shiva (Wunsch, Bewusstsein, Handlung) oder Shiva, Shakti und Anu (sterbliches Individuum) oder Pati Pascha, Pascha (Meister, Sklave und ihre Verbindung) bedeutet. Es gibt auch andere Abteilungen.
Im Allgemeinen zeigt der Kaschmir-Shaivismus Einheit ...
In diesem Artikel (möge er zum Wohle aller Lebewesen dienen) werden wir über ein einzigartiges – teilweise sogar fantastisches – Phänomen sprechen, das dennoch zufällig zu einer Weltreligion wurde. Das ist Buddhismus. Was ist es, woher kommt es, wann und unter welchen Umständen erschien es usw. usw. - das alles ist eine zu umfangreiche Aufgabe, für deren Umsetzung selbst ein großes Buch, geschweige denn ein kurzer Artikel, nicht ausreicht. Deshalb beschränken wir uns hier darauf, nur eine zu studieren...
Die Belohnung steht immer im Verhältnis zu der Sache, der wir dienen; Es kommt erst, wenn das Ziel erreicht, die Arbeit erledigt und die Kraft gewonnen ist, und nie zuvor. Dies gilt sowohl für die spirituelle als auch für die materielle Entwicklung.
Es muss daran erinnert werden, dass spirituelle Stärke auf die gleiche Weise entwickelt werden muss wie die Sinne. Deshalb müssen wir, bis wir es erworben haben und nur auf der Ebene existieren können, die unseren äußeren Sinnen zugänglich ist, für eine Weile die anderen Ebenen vergessen und darüber nachdenken, was spirituelle und...
Einführung
Zu allen Zeiten der Menschheitsgeschichte haben Menschen nach Gott gesucht, und die verschiedenen Religionen der Welt waren Gottes Antwort auf diese Suche, eine Antwort, die von Menschen gegeben wurde, in deren Seelen Er sich stärker offenbarte als in den Seelen gewöhnlicher Menschen.
Diese Menschen wurden unterschiedlich genannt: Propheten, Rishis, Gottmenschen, Söhne Gottes, und wir können sie als eine große spirituelle Bruderschaft betrachten, die aus von Gott inspirierten Menschen, Wächtern und Lehrern der Menschheit besteht. Wir müssen sie behandeln mit...
Es gibt nichts Unähnlicheres als Himmel und Erde, wie ein Lehrer sagt. Die Erde spürte in der Tiefe ihrer Natur, dass sie dem Himmel fremd und unähnlich war. Deshalb floh sie vom Himmel in die Tiefe und lag dort regungslos und still, um dem Himmel nicht näher zu kommen. Und der Himmel erkannte in seiner tiefsten Natur, dass sich die Erde von ihm entfernt und tiefe Orte eingenommen hatte. Deshalb schüttet es seine Fruchtbarkeit unkontrolliert in ... aus.
Religiöse Vorstellungen werden einerseits von modernen wissenschaftlichen Ideen beeinflusst. Andererseits gibt es eine Wiederbelebung des Interesses an der Mythologie, an jenen Existenzvorstellungen, die Mythen zum Ausdruck bringen. Die Konzepte von Raum und Zeit sind grundlegende Konzepte der menschlichen Kultur. „Sie sind so grundlegend, dass sie in einem bestimmten Stadium der Entwicklung des menschlichen Wissens (oder der menschlichen Unwissenheit) als die absolute Substanz der Welt angesehen wurden. Solche sind Zrvan im frühen Zoroastrismus, Chaos in der antiken griechischen Mythologie, Akasha und Kala im alten Indien.“ Systeme usw.“ Gleichzeitig ist es heutzutage schwierig, solch moderne Existenzmodelle zu finden, die keine archaischen Vorbilder haben. Beispielsweise kam das geometrodynamische Programm von J. Wheeler der „mythologischen“ Idee nahe, dass es auf der Welt nichts außer leerem gekrümmten Raum gibt, und die relativistische Kosmologie verwendet das archaische Konzept des „Anfangs“ der Zeit.
„Die außergewöhnlich starke Ausrichtung des mythologischen Denkens auf die Etablierung des Homöo- und Isomorphismus machte es einerseits wissenschaftlich fruchtbar und bestimmte andererseits seine periodische Wiederbelebung in verschiedenen historischen Epochen.“ Die moderne Wissenschaft entdeckt verschiedene Symbole des Todes – der Wiedergeburt in der jüdisch-christlichen Tradition, in den Legenden von Isis und Osiris, in wenig bekannten Varianten aus den präkolumbianischen Kulturen Amerikas. In veränderten Bewusstseinsformen ist es möglich, genaue Informationen über verschiedene, bisher unbekannte Aspekte des Universums zu erhalten, was an sich eine grundlegende Überarbeitung der Konzepte über die Natur der Realität, über die Beziehung zwischen Bewusstsein und Materie erfordert.
Die Idee der Welteinheit
Die Welt ist nicht nur vielfältig, sondern auch vereint. Diese Idee drückt eines der wichtigsten philosophischen Probleme aus. Auf der Suche nach einer Antwort auf diese Frage (Ist die Welt eine?) entstanden Weltanschauungssysteme wie der Dualismus von Descartes, der monistische Pantheismus von Spinoza und der monadologische Pluralismus von Leibniz. Selbst die materiellen Bestandteile der Welt lassen sich im modernen Weltbild auf abstrakte Muster und auf das „dynamische Vakuum“ zurückführen. Im einheitlichen Netzwerk des Universums sind alle Strukturen, Formen und Unterscheidungen äußerst willkürlich und Form und Leere sind relative Konzepte. Die heute bekannten Strukturebenen der Materie, von den Elementarteilchen bis zur Metagalaxie, stellen nur einen kleinen Teil der gesamten Vielfalt und Unendlichkeit der Welt dar.
Entstehung und Entwicklung des wissenschaftlichen Weltbildes
Das von Ptolemäus geschaffene geozentrische Weltbild wurde in der Wissenschaftsgeschichte durch das heliozentrische System abgelöst Nikolaus Kopernikus (1473–1543). Die kopernikanische Revolution lehnte den von Aristoteles stammenden und von der Scholastik unterstützten Gegensatz zwischen Himmels- und Erdkörpern ab und bereitete den Boden für die Lehre vom natürlichen Ursprung und der Entwicklung des Sonnensystems. Die Geburt der Kosmologie bereitete die Geburt der Wissenschaft vom Universum als einem einzigen zusammenhängenden Ganzen vor. Von gleicher Bedeutung für die Philosophie und Wissenschaftsgeschichte der letzten zwei Jahrhunderte war einer der größten französischen Philosophen, René Descartes. Sein bedeutendster Beitrag zum Leitbild der Welt war der äußerst geschärfte Begriff der absoluten Dualität von Geist und Materie, der die Überzeugung zur Folge hatte, dass die objektive Welt objektiv, ohne Bezug auf einen menschlichen Beobachter, beschrieben werden kann. Dieses Konzept diente als Werkzeug für die rasche Entwicklung von Naturwissenschaften und Technik. Es hatte jedoch eine unerwünschte Konsequenz: die Zerstörung eines ganzheitlichen Ansatzes zum Verständnis von Mensch, Gesellschaft und Leben auf dem Planeten. In gewisser Weise erwies sich Descartes‘ Erbe als langlebiger als sogar der Newtonsche Mechanismus. Selbst Albert Einstein, das Genie, das die Grundlagen der Newtonschen Physik untergrub, die Relativitätstheorie formulierte und den Grundstein für die Quantentheorie legte, konnte sich dem Bann des Descartes‘ Dualismus nicht ganz entziehen. Das Newton-kartesische Modell hat sich in verschiedenen Bereichen als äußerst erfolgreich erwiesen. Es bot eine umfassende Erklärung der grundlegenden Mechanik des Sonnensystems und wurde erfolgreich zum Verständnis der kontinuierlichen Flüssigkeitsbewegung, der Vibration elastischer Körper und der Thermodynamik eingesetzt. Sie wurde zur Grundlage und treibenden Kraft für den bemerkenswerten Fortschritt der Naturwissenschaften im 18. und 19. Jahrhundert. Allmählich entstand das Konzept eines sich selbst entwickelnden Universums.
Dynamik von Weltbildern im 20. Jahrhundert
Im 20. Jahrhundert Der revolutionäre Zusammenbruch grundlegender physikalischer Prinzipien und Konzepte führte zur Schaffung neuer Konzepte, die tiefer und genauer waren als die vorherigen. Es wurde festgestellt, dass es Elemente mit gleichem Atomgewicht, aber unterschiedlichen chemischen Eigenschaften gibt. Ein ähnliches Phänomen hätte vor einigen Jahren unter Chemikern für Spott gesorgt. Es gibt Hinweise auf die komplexe Natur von Atomen, daher besteht kein Zweifel daran, dass schwere Atome aus leichteren Atomen aufgebaut sind. Das Atom ist nicht mehr die primäre Einheit der Materie, da seine Struktur nachweislich sehr komplex ist. Die kleinsten heute bekannten Materieteilchen sind Elektronen und Positronen. Beide haben die gleiche Masse, unterscheiden sich aber in der elektrischen Ladung: Das Elektron ist negativ geladen, das Positron ist positiv geladen. Zusätzlich zu diesen Teilchen gibt es schwerere Teilchen – Protonen und Neutronen, die Teil der Kerne sind. Auch ihre Masse ist ungefähr gleich (1840-fache Masse eines Elektrons), aber während ein Proton mit positiver Elektrizität geladen ist, trägt ein Neutron keine Ladung. In der Zusammensetzung der kosmischen Strahlung, die aus dem interstellaren Raum in unsere Atmosphäre eindringt, wurde kürzlich eine ganze Reihe neuer Teilchen entdeckt, deren Masse in sehr großen Grenzen schwankt. In der modernen physikalischen Literatur wird die Umwandlung eines Elektron-Positron-Paares in Strahlung oft als Vernichtung (Zerstörung) von Materie bezeichnet; den umgekehrten Vorgang nennt man Materialisierung. Auch die Transpersonale Psychologie bietet neue Modelle des Universums.
Was bedeutet das Wort „Sein“? Vielleicht erhalten wir die Antwort, indem wir uns der Interpretation des Wortes selbst zuwenden. „To be“ bedeutet „wachsen, wachsen, werden“. Aber das Wort „sein“ kann nicht durch etwas Allgemeineres und Sinnvolleres definiert werden. Vielleicht glaubte Hegel deshalb, dass der Begriff des Seins der leerste und abstrakteste sei, identisch mit dem Nichts. Der deutsche Philosoph G. Lotze glaubte, dass Sein grundsätzlich nicht definierbar und nur erfahrbar sei. Sein ist das Letzte, wonach man fragen kann. Aber lässt sich Letzteres feststellen? Schließlich steckt nichts mehr dahinter. Sein ist die Essenz der Existenz. Deshalb zwingt uns die Entwicklung der Wissenschaft, die ständig neue Bilder der Welt bietet, dazu, den Begriff des Seins neu zu überdenken. Im 20. Jahrhundert ersetzen sich ständig neue und vielfältige Weltbilder. Bedeutende Entdeckungen in Mathematik, Lasertechnologie, Holographie, quantenrelativistischer Physik und Hirnforschung haben zur Entstehung neuer Prinzipien geführt, die weitreichende Perspektiven für die moderne Erforschung von Existenz, Bewusstsein und anderen Phänomenen eröffnen.
Jetzt, zur Zeitenwende, suchen Russland und die gesamte slawische Welt nach einer einigenden Idee. Und jedes slawische Volk sucht nach seiner eigenen nationalen Idee. Russen nennen es die „russische Idee“, Ukrainer „ukrainisch“, Polen „polnisch“, Serben „serbisch“ usw. usw. Und es kommt vor, dass sie die Ideen als gegensätzlich verstehen. Die Slawen sind durch ihren Glauben, ihre Sprache und ihre sozialen Strukturen gespalten.
Die Spaltung innerhalb der slawischen Welt hält an. Und natürlich wird die Idee der „Trennung“ von außen befeuert.
Aber ist das der Punkt? Sind wir nicht diejenigen, die nachgeben und sich als geistig schwach erweisen? Das 20. Jahrhundert zeigte einmal mehr, dass die gefährlichsten und blutigsten Konflikte, die die Slawen schwächen, innerhalb der slawischen Welt selbst entstehen. Dazu gehören Bürgerkriege und interreligiöse Kriege. Und feindliche äußere Kräfte nutzen die Schwäche und Uneinigkeit der Slawen aus.
Und dem kann nur eine einigende panslawische, slaworussische Idee widerstehen. Genau das verkündet das „Buch Veles“. Auf vierzig Tafeln verwendet das „Buch Veles“ Wörter mit der Wurzelbasis „Einheit“ 34 Mal und niemals „Trennung“.
Hier sind die folgenden Aufrufe zur Einheit der Slawen aus dem „Buch Veles“:
„Erinnern wir uns, wie unter dem Vater von Ari der Clan der Slawen vereint wurde und seine drei Söhne den Clan in drei Clans aufteilten. Und dann wurden die Ruskolaner und die Wenden in zwei Clans aufgeteilt Dies geschah mit den Boruss, die sich in zwei Teile spalteten. Und das wird auch so bleiben, wenn wir uns bis ins Unendliche teilen. Und dass die Borusse vereint bleiben und sich nicht trennen.
Und so beginnen wir uns an Mosca zu erinnern, der die Slawen vereinte und sich um die Einheit des Landes kümmerte. Und er hatte Intelligenz. Und er kümmerte sich um uns. Und dann gingen wir getrennte Wege. Und bestimmte Clans strömten nach Norden, und das waren die Vyatichi und Radimichi.
Und so beschlossen sie beim Treffen mit ihren Führern, an die Donau und darüber hinaus zu gehen. Und von da an drehten wir uns um und wurden sofort frei. Sie sprachen über die Einheit unserer Clans, über die Harmonie von Clan zu Clan. Und sie besiegten die große Macht, indem sie sich vereinten. Und damals waren unsere Väter damit einverstanden.
Die Idee der slawischen Einheit zieht sich durch das gesamte Buch Veles. Darüber hinaus ist fast die wichtigste feindliche Kraft, die die Slawen schwächt, der Versuch, den einen oder anderen Stamm oder Clan zu isolieren.
Und das „Buch Veles“ spricht nicht nur von der slawischen Einheit. Sie fordert auch die Einheit mit den finnischen und baltischen Völkern (Ilmerier, Zemegoloy, Chud) sowie mit den kaukasischen Clans der Ironier (Alans).
Darin liegt sogar Trauer über die langjährige Trennung von den deutschen Clans, die zu Kriegen führte. Und nach den Kriegen werden die Slawen ein Bündnis und einen ewigen Frieden mit den hunnischen (ugrischen und türkischen) Clans schließen.
Und diese Idee im „Buch Veles“ ist die Essenz der „russischen Idee“ in ihrem ursprünglichen Verständnis. Warum Russisch? Und wen nennt das Buch Veles die Rus?
Im weitesten Sinne versteht die slawische Tradition unter „Rus“ alle Völker der weißen Rasse. Nicht nur die Slawen, sondern auch die Deutsch-Skandinavier, romanische Völker, Finnen, Türken, Kaukasier und andere.
Die Rus in der slawischen Tradition sind die Nachkommen von Dazhbog und Ros, die sich auf der ganzen Welt niederließen. Aus diesem Grund sind Ethnonyme und Toponyme mit der Wurzel „Rus“ in ganz Eurasien so verbreitet.
Der Name „Rus“ wird auch von den Skandinaviern verehrt. Seit langem versuchen sie uns sogar einzureden, dass sie es waren, die den Russen diesen Namen gegeben haben. Und was ist mit den alten Etrusker-Pelasgern, die sich selbst „Rasena“ nannten und die Vorfahren und Lehrer vieler westeuropäischer Völker und vor allem der alten Römer wurden? Was soll ich sagen, selbst der Name der Stadt Yerusalim (altrussisch Rusalim) bedeutete ursprünglich „russische Stadt“.
Die Slawen sind nach der vedischen Tradition und dem Buch Veles die Nachkommen von Slava und Bogumir, ursprünglich einem der nordrussischen Clans, der später in östliche Clans und Stämme aufgeteilt wurde: die Polyans, die Drevlyans, die Dregovichs, die Nordländer, auch Vyatichi, Krivichi, Radimichi; Westlich: Tschechen, Slowaken, Karpfen, Polen, Slowaken und andere; dann die südslawischen Clans: Bulgaren, Serben, Kroaten usw.
Unter den Slawen hebt das „Buch von Veles“ auch die Clans der alten Ruskolani hervor, eigentlich „russische Clans“, die nur diesen Namen trugen, denn sie waren nicht nur Nachkommen von Ros, sondern auch von Patriarch Rus, einem der Nachkommen von Slava und Bogumir. „Rus“, im engeren Sinne die Nachkommen des Patriarchen Rus, lebten an Wolga und Don sowie im Nordkaukasus. Sie wurden in mehrere Clans aufgeteilt: Belogors, Beloyars, Novoyars. Die Ruskolan-Clans (Russisch-Alan) waren auch die Nachkommen der Skythen und Sarmapier – der Berendeys und Ironier (Alans).
Und jetzt haben die Kosaken, sowohl die Russen als auch die Ukrainer, den meisten Grund, sich Rus zu nennen. Der Name „Kosak“ bedeutet „Belogor“ (im modernen Bulgarisch sowie in den türkischen und ugrischen Sprachen bedeutet „kaz“ „Berg“ und „ak“ bedeutet „Weiß“). Und das ist der älteste Name, der auch im „Buch Veles“ steht.
Aber die Hauptsache ist natürlich nicht der Name, sondern die Tatsache, dass die Kosaken bis heute die Bräuche der alten Veche-Volksherrschaft, den „Kosakenkreis“, den „Kosakenwillen“, auch die Liebe zur Antike, bewahrt haben. „schikanieren“.
Was ist die Essenz der Idee der „Einheit“ nach dem „Buch Veles“? In der spirituellen Einheit, die die ursprüngliche vedische Tradition bietet, in der Einheit der Ideale, in einem gemeinsamen Verständnis davon, wie man „in Wahrheit“ lebt. So wurde sie in der antiken slawischen Welt gesehen. Und dieselbe Idee kann und sollte in ihrer Entwicklung im modernen Russland gefragt sein.
Russland ist nun auf der Suche nach einer eigenen nationalen Idee. Eines, das alle seine Völker vereinen und der Entwicklung unseres Landes Impulse geben könnte.
Und ich bin sicher, dass zu diesem Zweck die jahrhundertealten vedischen Ideen, die im „Buch von Veles“ und in der Volkstradition enthalten sind, gefragt sein können und sollten.
Diese Ideen haben Russland zu allen Zeiten gerettet. Und alle ausländischen – sowohl byzantinisch-christliche als auch verwestlichte und kommunistische und moderne kosmopolitische und andere – haben in Russland nur insoweit Wurzeln geschlagen, als sie selbst unsere alten Vorfahren vedischen Ursprungs absorbierten. So war es, so ist es und so wird es sein.
Vedische Ideen sind stark, weil sie sowohl mit der Natur des Menschen selbst als auch mit der Natur um ihn herum im Einklang stehen. Das ist unsere Geschichte, unsere Wurzeln. Schneiden Sie die Wurzel ab und der Baum verdorrt. Und wird das russische Volk jetzt nicht zu einem verdorrten Baum, ohne den es für Russland selbst kein Leben gibt?
Jemand könnte einwenden: Sie sagen, wir sprechen von einer toten Tradition, einer vergessenen Zivilisation, einem Glauben. Die vedische Zivilisation wurde besiegt, was bedeutet, dass sie schwach war ...
Aber das ist nicht so. Die alte Tradition wurde nicht besiegt, sie wurde beiseite geschoben. Und der neu entstandene christliche Glaube existierte im ersten Jahrtausend seiner Geschichte auf russischem Boden (vom Apostel Andreas bis zum Fürsten Wladimir) nicht nur neben dem vedischen Glauben, sondern war im Wesentlichen dessen Zweig. Und erst dann änderte sich unmerklich alles.
Und die neuen Ideale, die durch die neue Lebensweise entstanden, waren nicht so ein Segen, wie viele glauben, nicht nur in Russland.
Nehmen wir ein Beispiel – das Byzantinische Reich. Sie existiert nicht mehr und die griechisch-byzantinische Tradition ist in Teilen des Balkans kaum noch vorhanden. Die Hauptstadt von Byzanz, das ehemalige Konstantinopel, ging an die islamische Türkei über. Das ist jetzt Istanbul. Bedeutet das nicht, dass die byzantinische Version des Christentums schwächer ist als der Islam? Und wenn diese Geschichte weitergeht, heißt das dann nicht, dass Moskau, das Dritte Rom und damit das Zweite Konstantinopel, auch zum Zweiten Istanbul wird?
Nein, so funktioniert die Logik der Geschichte nicht. Und die Stärke der Rus lag und liegt nicht in dem, was sie vom gefallenen Byzanz geerbt hat, sondern in der Tatsache, dass unsere Volkstraditionen fest in ihrem Heimatland verwurzelt sind.
Und jedes Land, das an diesen Wurzeln festhält, bleibt stark und wohlhabend. Ein Beispiel hierfür sind moderne Länder. Zum Beispiel Indien, Japan. Ja, das gleiche Israel. Einer der wichtigen Lebensindikatoren, insbesondere für uns Russen: das Bevölkerungswachstum. Indien kann in dieser Hinsicht noch viel lernen. Mittlerweile lebt ein Viertel der Erdbewohner in Indien. Japan ist ein kleines Land, aber es gibt mittlerweile so viele Japaner darin wie Russen in Russland.
Werden wir unsere riesigen Grenzen beibehalten? Die Russen sterben aus. Jedes Jahr kommt es zu einem Rückgang um Millionen. Bei einem solchen Rückgang der Geburtenrate werden wir Mitte des nächsten Jahrhunderts halb so viele von uns haben, und am Ende des Jahrhunderts wird es überhaupt keine mehr geben. An unsere Stelle werden Menschen treten, die sich zum Islam bekennen.
Und hier geht es genau um die Ideale, die heute in der Gesellschaft, in der Lebensweise und in der Erziehung selbst akzeptiert werden. Waren die Russen im 19. Jahrhundert reicher als heute? Verfügte das Land damals über ein solches industrielles Potenzial, das das Leben einfacher machte? Helfen uns die neuesten Technologien heute nicht dabei, Nahrung zu beschaffen, uns anzuziehen und sogar Kinder großzuziehen? Warum sterben trotz all dieser Vorteile Menschen aus?
Manche Leute denken, dass es hier genau um diese Vorteile geht, die Sünde der Zivilisation. Dass wir zur Fackel, zum Patriarchat in diesem Sinne, zurückkehren müssen.
Aber das ist nicht so! Vedische Länder (z. B. Japan) zeigen, dass es nicht darum geht, ob sich ein Land auf dem Weg des technischen Fortschritts entwickelt, sondern darum, ob es seine angestammten Wurzeln bewahrt hat. Das ist genau der Punkt. Die Essenz liegt im Bewusstsein der Menschen, in der Bildung.
In vedischer Zeit waren die Slawen das zahlreichste Volk Europas. Und aus diesem Grund konnten wir auch nicht durch die Grenzen desselben Byzantinischen Reiches eingedämmt werden. Und so besetzten wir den Balkan und besiedelten fast die Hälfte seiner entvölkerten Gebiete. Und bis heute genießen wir das gleiche Erbe, obwohl wir bereits von allen Seiten von anderen Völkern bedrängt werden.
Welchen Weg also einschlagen? Ist es wirklich möglich, Energie nicht darauf zu verwenden, Wurzeln zu schlagen, sondern für etwas, das sich bereits als nicht lebensfähig erwiesen hat?
Neueste Site-Materialien
Wasserhähne

Zehn Menschen, die im letzten Jahrtausend den Lauf der Geschichte und das Bewusstsein der Menschheit verändert haben
Der Herrscher der Mongolen schuf das größte Reich der Geschichte, das im 13. Jahrhundert weite Gebiete Eurasiens vom Japanischen Meer bis zum Schwarzen Meer unterwarf. Er und seine Nachkommen fegten große und alte Staaten vom Erdboden: den Staat der Khorezmshahs, das Chinesische Reich,
Installation

Warum träumt ein Zwerg von einem wütenden Mann?
Ein Traum, in dem Ihnen ein hässlicher Zwerg erscheint, sagt ein Treffen mit bösen, unfreundlichen Menschen voraus. Wenn Sie im Traum mit einem Zwerg sprechen, müssen Sie sich in Wirklichkeit mit einer Person auseinandersetzen, die Ihnen gerade wegen seiner Erbärmlichkeit und Bedeutungslosigkeit unangenehm ist
Senkgrube

Warum träumst du von einer Katze – Interpretation des Schlafes aus Traumbüchern
Traumdeutung von G. Miller Warum träumen Sie von einer Katze - psychologische Interpretation: Katze - Wenn eine Frau von einem bezaubernden, flauschigen, weißen Kätzchen träumt, ist dies für sie ein Omen, dass sie durch geschickte Täuschung in eine gelockt wird Es ist eine Falle für sie, aber ihre Gesundheit
Heizung

Wie erstellt man nach Abschluss eines Kauf- und Verkaufsvertrags eine Wohnungsannahme- und Überlassungsbescheinigung korrekt?
Die tatsächliche Übergabe der Wohnung durch den Verkäufer an den Käufer und deren Abnahme wird in der Abnahmebescheinigung festgehalten. Die Verpflichtung zur Erstellung dieses Dokuments ist in Artikel 556 enthalten. Bürgerliches Gesetzbuch der Russischen Föderation. Der Akt der Annahme und Übertragung einer auf dem Zweitmarkt erworbenen Wohnung hat in der Regel einen vereinfachten Aufbau
Projekte
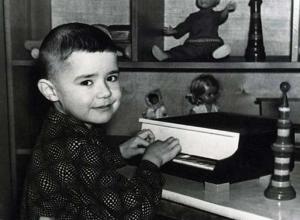
Evgeny Osin ist gestorben – Biografie, Familie und Privatleben, woran er erkrankt war, Todesursache. Biografie des Sängers Evgeny Osin
Evgeny Viktorovich Osin. Geboren am 4. Oktober 1964 in Moskau – gestorben am 17. November 2018 in Moskau. Russischer Sänger, Musiker, Songwriter. Vater - Viktor Osin, arbeitete als Trolleybusfahrer. Hat eine jüngere Schwester Albina. Sein Onkel war Schlagzeuger in
Rohre

Was ist der Sinn des menschlichen Lebens: eine Sichtweise aus Philosophie, Religion und Psychologie
Aristoteles Viele Menschen stellen die Frage: Was ist der Sinn des Lebens? Und dann suchen sie fleißig nach der Antwort auf diese Frage, indem sie verschiedene Meinungen berühmter und weniger berühmter Personen studieren, die in zahlreichen Informationsquellen zu finden sind. Und dazu gibt es viele Meinungen